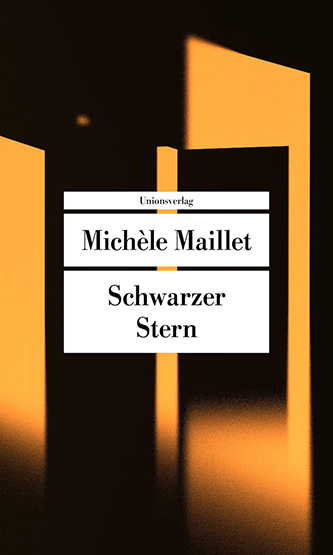Wir kennen Pascal schon ein bisschen. In „Ungeteerte Straßen“ ließ er uns an seiner Kindheit teilhaben. „Am anderen Ende der Stadt“ tauchten wir tief in die Gedanken eines Heranwachsenden ein. Nun, fast schon ein Mann, beginnt für ihn der Ernst des Lebens. Allerdings nicht im heimatlichen Toulon, am Meer, den Bergen im Hinterland, sondern im weit entfernten Deutschland. In Freiburg. Das Vaterland verlangt – Ende der Sechziger Jahre üblich und nicht diskutabel – seinen Tribut.
Zum Glück sind bei ein paar Leute, die wie er die Liebe zum Rugby teilen. Das erleichtert die Eingewöhnung erheblich. Doch Deutschland ist kalt. Was zuerst als Spaß gedacht war, wird nun bitterer bzw. bitterkalter Ernst. Die wenigen freien Stunden verbringt man mit Flirten, Rauchen und Träumereien. Immer im Gepäck: Lyrik von Jacques Prevert. Dem Pazifisten. Das fällt auch Madame Da Silva auf. Zwischenzeitlich hat sich aus dem dreckigen Militärdienst klischeehafter Vorstellung das Tor zum Paradies weit geöffnet. Pascal darf – und nur so kann man den göttlichen Wink des Schicksals bezeichnen – als Chauffeur für die Gattin des Generals ein durchaus privilegiertes Leben führen. Zwar als Soldat der Armee, dennoch im zivilen Leben. Die Neider verstummen für Pascal schon bald. Denn er kann sie nicht hören. Die Kaserne ist weit weg. Das Leben wartet auf den Wissbegierigen.
Den Dienst verrichtet er wie es sich gehört. Eine Rüge wegen Unordnung und Unachtsamkeit nimmt er hin. Solange er nur in die Stadt kommt. Uschi, Martina und dann doch Verena sind ihm näher als jemals zuvor ein Mensch war. Rückschläge inklusive. Doch Verena … ja, Verena kommt er näher als er es sich erträumen ließ.
Wieder einmal beweist Gérard Scappini, dass das harte Leben mit liebevoller Poesie durchaus zu beschreiben sein kann. Pascal ist das alter ego des Autors. Pascal lernt zu überleben in einer Umgebung, vor der seine Eltern ihn bisher beschützen konnten. Nun muss er auf eigenen Beinen stehen. Der Lernprozess ist fortwährend, doch das weiß er erst, wenn er mittendrin ist. Zwischen dem, was er kennt, und dem, was er noch kennenlernen wird, liegen Welten. Nicht nur geographisch. Zwischen akkurat geschnittenen Haaren und freigeistigen Hippies, zwischen Prevert und Beat, zwischen Heimat und Aufbruch, wiegt sich ein junger Mann, dem man gern auf humorvollen Sohlen folgt. Immer wieder ertappt man sich wie man dem blitzgescheiten Pascal bei naiver Träumerei nur das Beste wünscht. Teil Drei der lyrischen Prosabiographie lässt die Unbekümmertheit der ersten beiden Bände hinter sich, überrascht im Gegenzug durch neuerliche Anwandlungen von überbordendem Lebensglück.