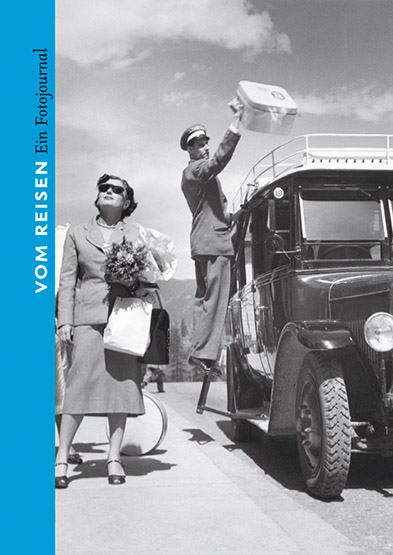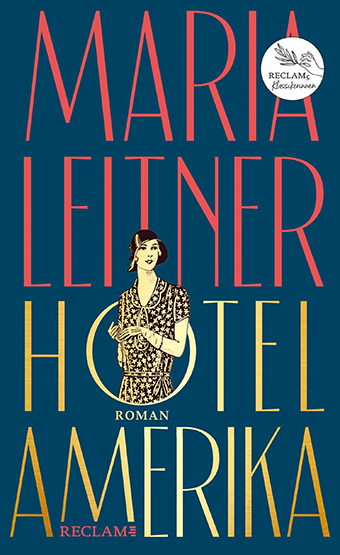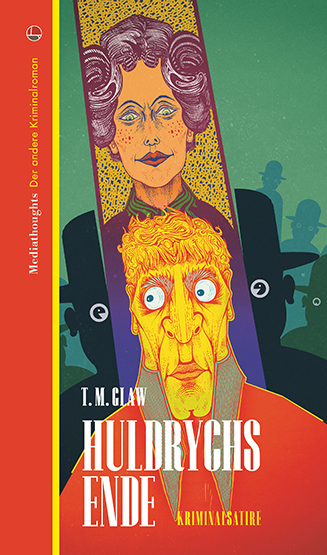Es ist ein wenig frevelhaft, wenn man den Gardasee nur mit Massen, die sich durch die engen Gassen schleppen in Verbindung bringt. Hier im Norden Italiens, wo Berge und Meer eine perfekte Symbiose eingegangen sind, gibt allen Unkenrufen zum Trotz, noch einen oder anderen Ort, an dem man tatsächlich Ruhe genießen kann. Ganz ohne Verkehrslärm, ohne die üblichen Sitzplatzblockierer in Fußballshirts und ohne hektisches Getrappel auf steinigen Pfaden. Man muss allerdings die Füße in die Hand nehmen und so manchen Aufstieg meistern. Als Belohnung winken atemberaubende Aussichten, leckere Mahlzeiten und ewige Erinnerungen.
„Immer diese Aussicht“ ist beispielsweise eine Wanderung überschrieben. So viel Zeit für die lachende Wahrheit muss sein. Und tatsächlich kommt man vor lauter Aussicht auf der Wanderung von Sasso zur Cima Comer kaum vorwärts. Also früh aufstehen und viel Zeit einplanen. Und unterwegs die richtige Abzweigung nehmen. Welche? Autor Peter Righi weiß es ganz genau! Als Belohnung warten ein palazzo con parco und immer wieder Aussicht, Aussicht, Aussicht. 180 Grad, mindestens.
Da fühlt man sich manchmal wie ein Blatt im Wind. Ein Papierblatt. Zumindest, wenn man von Toscolano Maderno nach Gaino wandert. Und zwar durch das Tal der Papiermacher. Exquisite Mitbringsel mit wenig Gewicht inkl.
Oder mal so richtig Geschichte tanken. Dem, der jahrelang Europa auf der Nase herumtanzte selbst mal auf selbiger herumtanzen. Um wen es geht? Na, um Napoleon. Ein ganz besonderer Ort, mit ganz besonderer Geographie. Und Geschichte.
Das „Oh!“ im Titel ist nicht einfach so herausgepurzelt. Es ist eine Buchreihe, die diesen Titel wahrhaft verdient. Natürlich ist der Gardasee eine Top-Destination, unbestritten. Und es gibt unzählige Bücher mit allerlei Geheimtipps. Aber wer per pedes dieses Paradies erkunden will, braucht Erstens keine Gängeli, Zweitens wirklich hilfreiche Tippe, Drittens Kartenmaterial, das aussagekräftig die Route vorgibt, Viertens Standorte zum Innehalten und Fünftens garantiert nicht pfundweise Papier, um von A nach B zu kommen. Oder kurz gesagt „Oh! Wandern am Gardasee“ ist die perfekte Quinte für den neugierigen Wanderer.