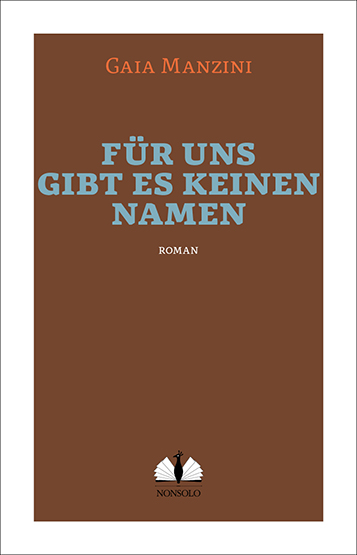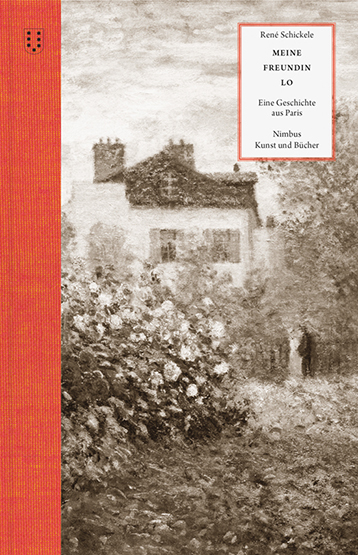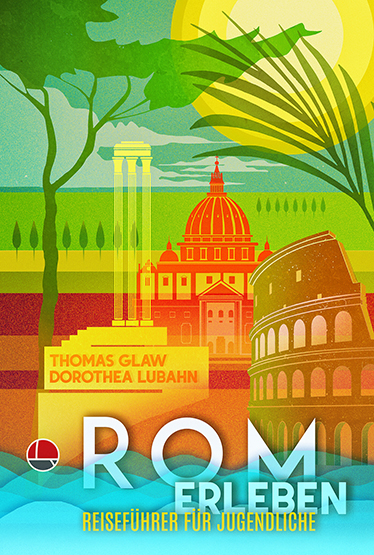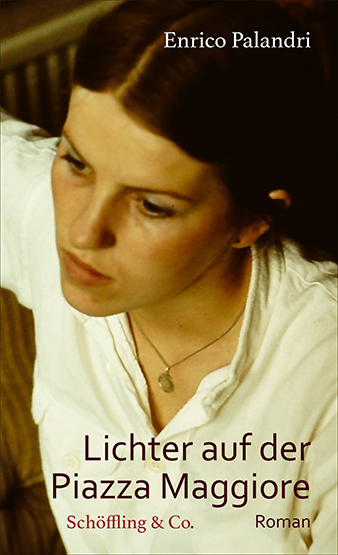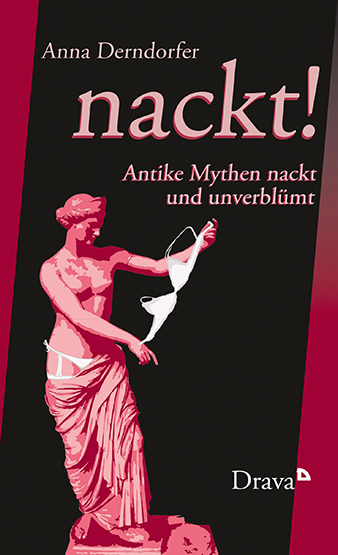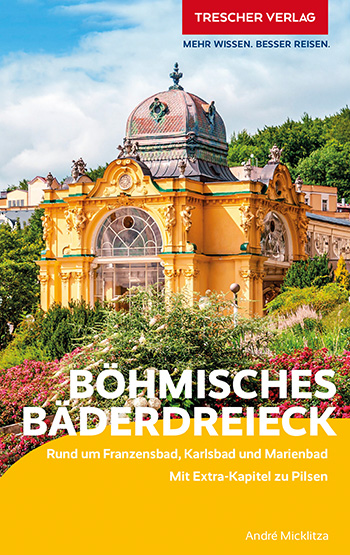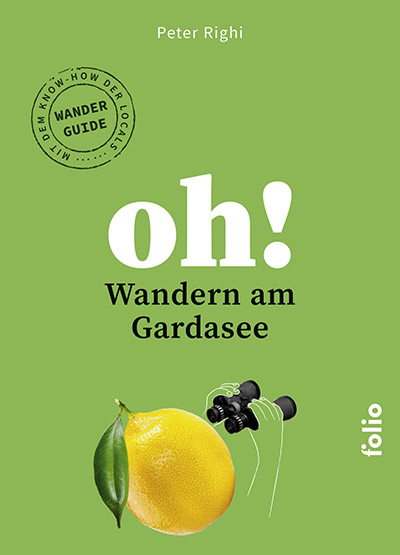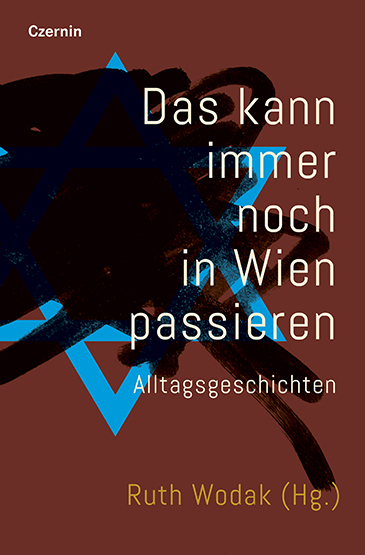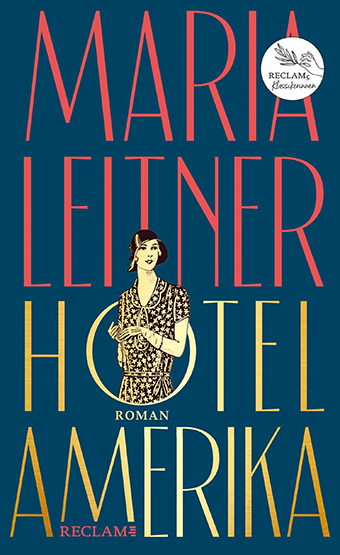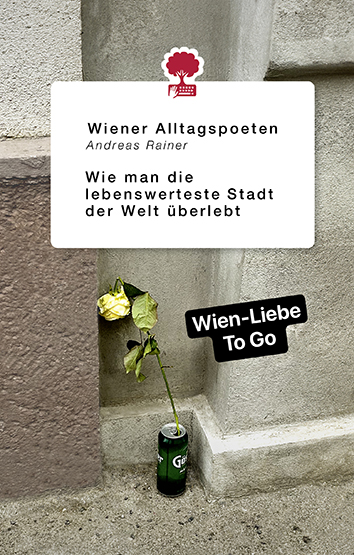Als Pechvogel kann man Ada nicht bezeichnen, aber eben auch nicht als Glückspilz. Mit Mitte Zwanzig steht sie am Anfang ihrer Karriere. In Mailand hat sie einen begehrten Job in einer Werbeagentur bekommen. Ihr gegenüber sitzt Alessio. Schüchtern, in sich gekehrt beginnt sie ihr neues Leben. Es wird aufregend. So sehr, dass sie vieles um sich herum vergessen könnte.
Mit 17 wurde Ada schwanger. Ihre Tochter Claudia wächst derweil bei ihren Eltern am Lago Maggiore auf. Eine echte Bindung zu der Kleinen kann sie kaum aufbauen. Am Meer, wo sie ein paar Tage gemeinsam verbringen, macht ihr ihr eigenes Dilemma sichtbar. Die Kleine zuckt bei jeder zärtlichen Geste zusammen. Die Distanz zwischen Mutter und Tochter ist sichtbar. Als Schutzschild vor Verletzungen behauptet Ada schon mal, dass Claudia ihre Schwester ist.
Mit Alessio läuft es gut. In jeder Hinsicht. Dass er schwul ist, scheint niemanden groß zu interessieren. Schon gar nicht die beiden selbst. Es entsteht ein Konstrukt, das man einfach nicht in Worte fassen kann.
Gaia Manzini zaubert aus dieser nicht greifbaren Situation mehr als ein Kaninchen aus ihrem Hut. Ada ist Hin und Her gerissen. Auch wegen Francesca. Sie könnte das Zünglein an der Waage sein. Für Ada, für Claudia, für ihre Familie und letztendlich auch für Alessio.
Normalerweise entwickelt man beim Lesen immer eine Vorstellung wie sich die Geschichte entwickeln könnte. Und dann ist man entweder überrascht, wenn’s anders kommt oder nickt freudig strahlend, wenn man dem Gedankengang des Autors folgen konnte. Hier liegt der Fall anders. Es ist unmöglich vorherzusagen, welche Wendungen auf alle Beteiligten warten werden. Wer dennoch richtig vermutet, hat geraten.
Die sanfte Wortwahl und die unaufgeregte Schreibweise verleihen „Für uns gibt es keinen Namen“ eine unstillbare Sehnsucht nach der nächsten Seite. Der Fortgang der Geschichte ist nur ansatzweise spürbar. Die Gänsehaut reicht trotzdem bis unter die Haut. Muss man öfter lesen.