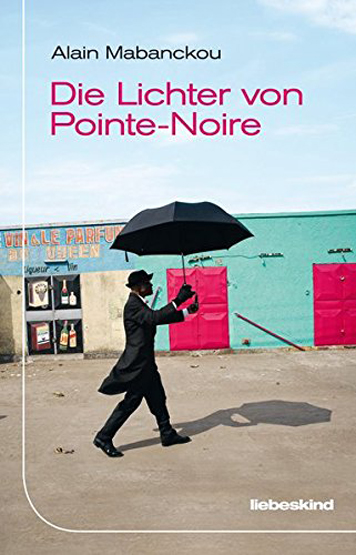Sie muss weg. Raus aus ihrem kleinen Dorf im Senegal. Europa ist das Licht am Ende des Tunnels, durch den die Reise führen wird. Es wird Belgien, und der Tunnel endet bei Weitem noch nicht in Brüssel.
Ken, so der Name der Erzählerin, unternimmt einen Riesenschritt, den sich viele niemals trauen würden. Wenn man sie nicht dazu treibt. Sie verlässt ihr Dorf, ihre Region, ihr Land, ihren Kontinent … ihre Kultur. Ken ist schlau, deswegen auch das Stipendium im fremden, fernen Europa. Zu ihrem Vater hatte sie nie das typische Vater-Tochter-Verhältnis. Als Oberhaupt der Dorfgemeinschaft war der der Übervater eines jeden einzelnen, jedoch nie der Vater seiner Kinder. Auch Mutter und Tochter konnten kein echtes vertrauensvolles Verhältnis aufbauen. Das, was alle zusammenhielt, war der Baobab. Der Affenbrotbaum. Unter seinem Blätterdach wurden Geschichten erzählt und Schutz gefunden.
Ihr Brüssel sucht Ken nun ihren Baobab. Doch den soll es hier nicht geben. Freunde findet sie schnell und reichlich. Doch die haben andere Intentionen als sie selbst. Wie eine Puppe wird sie herumgereicht. Eine Trophäe spätkolonialistischer Pubertierender. Einer ist homosexuell, von ihm dachte sie, dass er derjenige sein könnte, der …
Ken stürzt sich ins pralle Leben. Clubtouren, Drogen, Prostitution. Ihr Ritt auf der Rasierklinge fügt ihr Schnittwunden zu, doch niemals so tief, dass das Fleisch verletzt wird. Alles nur an der Oberfläche. In Afrika, im Senegal, in ihrem Dorf haben andere gefahren gelauert. Der Rektor, der sie heiraten will, nur um sich an ihr vergehen zu können oder der Lehrer, der sie bittet sein Messer zu schärfen, damit er ihr die Kehle durchschneiden kann – das hat sie stark gemacht. Sie zu einer selbstbewussten Frau reifen lassen. Doch diese reife ausleben, wäre nie in Frage gekommen.
Brüssel, Belgien, Europa bietet ihr diese Chance. Allerdings muss sie ihren Weg weitgehend allein beschreiten.
Ken Bugul beschreibt in „Die Nacht des Baobab“ einen großen Teil ihres eigenen Lebens. Was Fiktion und was Realität ist, wird nicht abschließend klar herausgestellt. Die eindrücklichen Sprachbilder jedoch helfen so manches Schicksal in einem anderen Licht zu sehen. Das Leben in der Fremde ist immer von Geheimnissen umgeben, wird durch die geprägt. Nur so viel preisgeben, dass man weiterkommen kann. Aber niemals die Seele oder gar das Herz offenlegen. Denn dann ist man anfällig für Verletzungen. „Die Nacht des Baobab“ gehört ohne Zweifel zu den reifsten Früchten der literarischen Flora Afrikas.