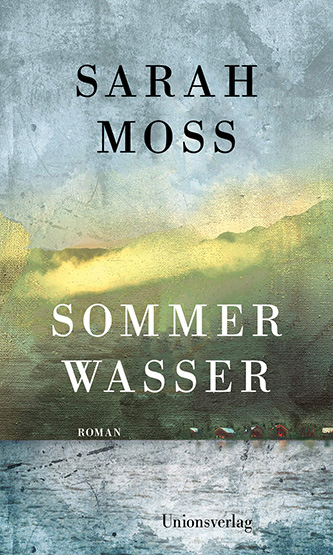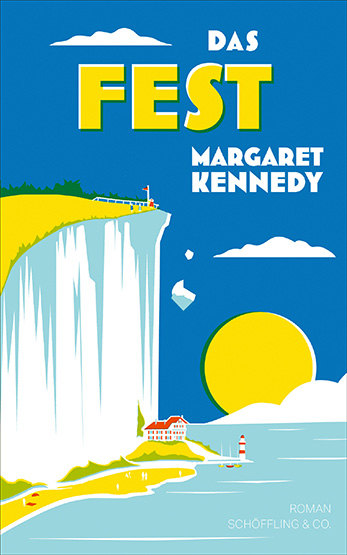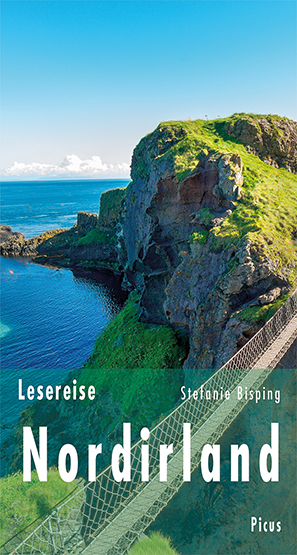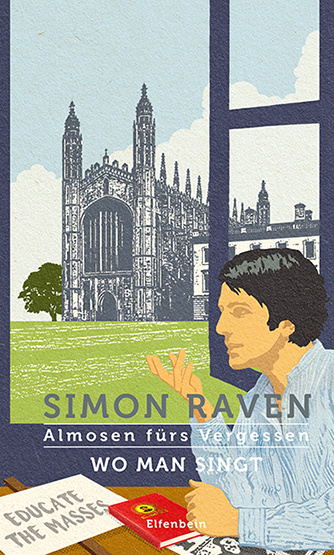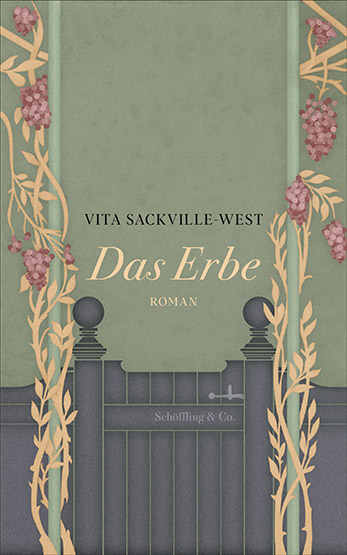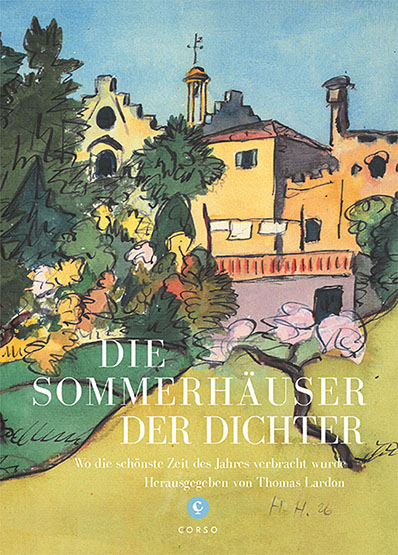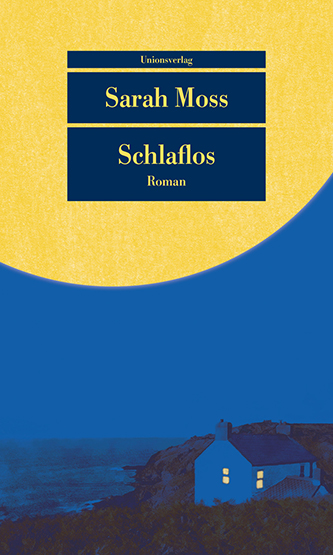Eine Ferienhaussiedlung in Schottland. Vor einem Wasser, über einem Wasser, unter einem Wasser. Selbst, wenn man zurückschaut Wasser, Wasser, Wasser. Es sollen unvergessliche Tage werden. In Schottland. Erholung, Ausspannen, ohne Zwang und Regeln. Doch wenn es regnet, ist man Gefangener im eigenen Traum. Vier Wände Plus. Das war’s.
Die Hausarbeit macht immer derjenige, der sie auch zuhause erledigt. Und Vorsicht vor den knarzenden Dielen! Nur nicht den Partner wecken. Der hat sich seine Auszeit redlich verdient. Kinderbespaßung bei Regen? Oh je, permanent ist man in der Pflicht der Familie nachhaltige Eindrücke zu vermitteln. Ferienhaussiedlung hin oder her – bei so viel Wetterabhängigkeit kehrt der Alltag schneller zurück als man sich ducken kann.
Sarah Moss nimmt diese spezielle Art des Urlaubens genauer unter die Lupe. Es sind keine kleinen Reportagen über nicht sitzende Fliegengitter oder planmäßige Wassereinteilung und Waschzeiten. Hier ist für den Komfort gesorgt. Nun muss der Gast nur noch seinen Platz finden. Meist geschieht das – im Regen – mit dem symbolischen Kissen unterm Arm. Schauen, wer noch so da ist, was die Anderen so treiben. Die Autorin schaut aus ihrem Fenster und sieht die Welt wie sie wirklich ist. Durchstrukturiert, und so gar nicht losgelöst von zuhause. Alles wie gehabt. Joggen, Frühstück machen, ein bisschen kajaken. Die innere Stoppuhr immer im Blick und niemals den Stoppknopf drückend.
Es sind keine bitterbösen Beobachtungen, die Sarah Moss in „Sommerwasser“ zum Besten gibt – und dieser Superlativ ist hier wirklich angebracht. Sie muss sich nicht verstecken, um „die Anderen“ zu beobachten. Hier schaut eh jeder auf den Anderen. Man zerreißt sich das Maul über die Aussprache eines Nachnamens. Wer sich für Fußball interessiert, dem kommt der Name Shevchenko eigentlich locker über die Lippen. Aber manchmal ist es doch angenehmer dem Frust über die eigene Unzulänglichkeit mit einer Brise Anmaßung („Scheiß-chenko“, Zitat) entgegenzutreten und sich zumindest einen Moment lang augenscheinlich zu erheben.
Die Frage, wann man „Sommerwasser“ lesen sollte, ist weitaus schwieriger zu beantworten als man sich eingestehen will. Liest man es vor dem Urlaub, in einer Ferienhaussiedlung, währenddessen oder lieber im Nachgang. Liest man es zu intensiv vor Abfahrt, kann die Stimmung abfallen und vor Ort nur noch durch permanenten Sonnenschein aufgehellt werden. Im Nachgang dieses Buch zu lesen, fördert sicherlich jede Menge Kopfnicken hervor. Wer sich in die Höhle des Löwen begeben möchte und den Mut aufbringt es zwischen Couch, Veranda und dem nächsten Ausflug zu lesen, muss sich auf allerlei Selbsterkenntnis einstellen. Fakt ist, dass Sarah Moss den Urlaubern nicht nur aufs Maul schaut, sondern mit dem ganz großen Holzlöffel ihre Seele gehörig zum Brodeln bringt.