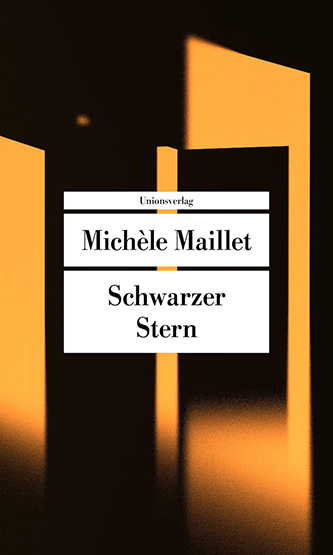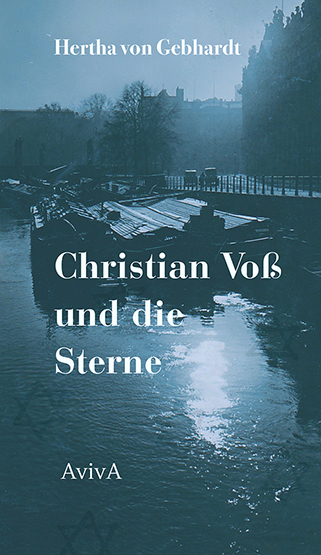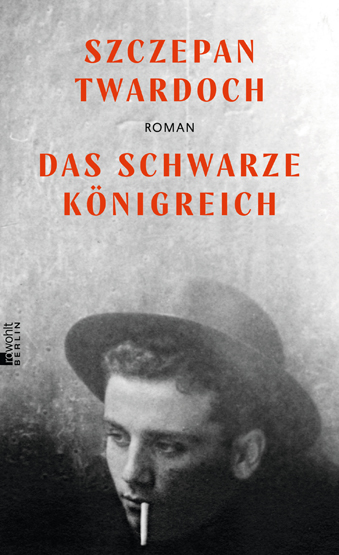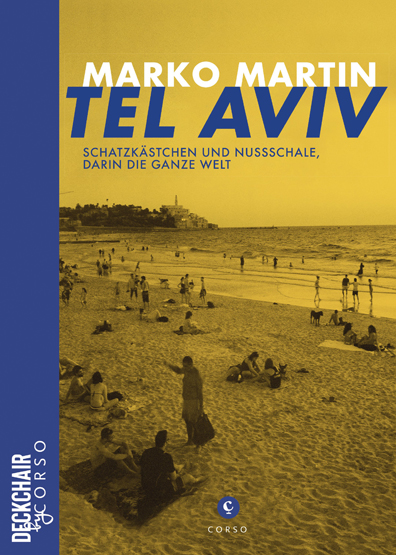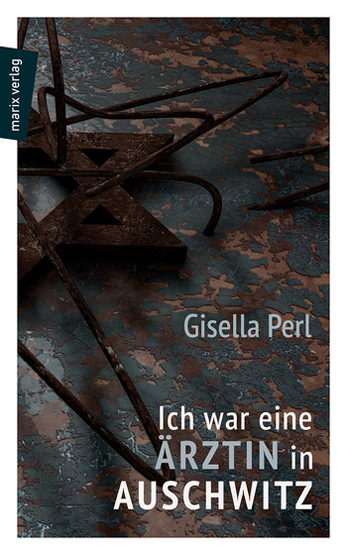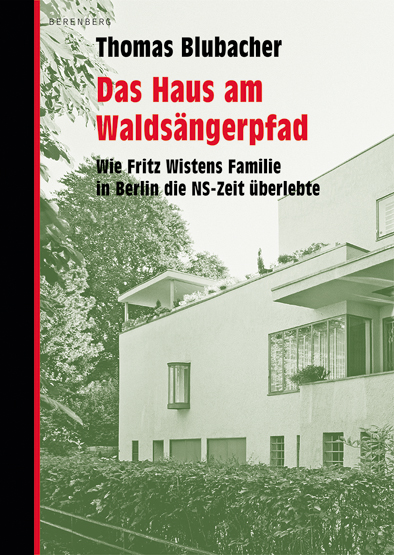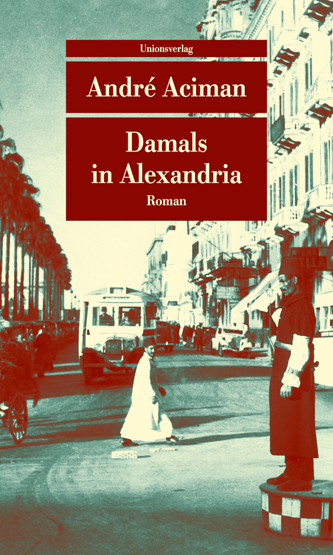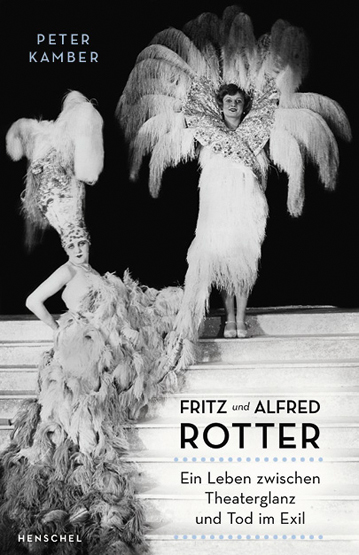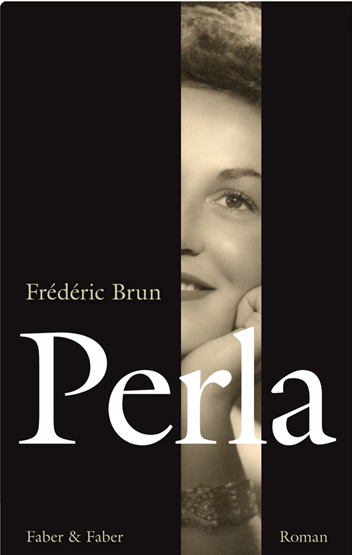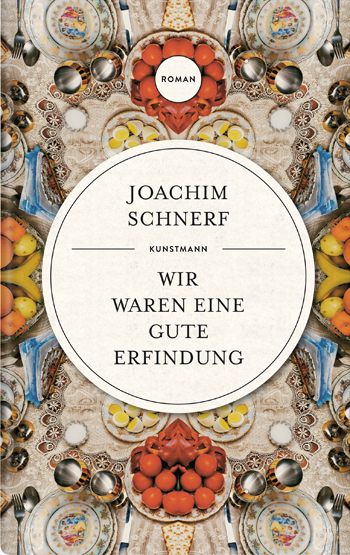Aus dem Schlaf gerissen zu werden, bringt das Blut in Wallung. Doch wenn Soldaten mit Waffen in die Wohnung eindringen, wo man als Hausmädchen arbeitet, die eigenen Kinder von den Eindringlingen wie Dreck behandelt werden, alle auf einen Laster verladen werden, ist ein unsanftes Aufgewecktwerden wie eine Wohltat.
Sidonie stammt aus Martinique und arbeitet bei den Dubreuils in der Nähe von Bordeaux als Hausmädchen. Sie sind ihre zweiten Eltern, die sie mitgenommen haben als sie von Martinique nach Frankreich zurückkehrten.
Die Dubreuils sind Juden – es sind die 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in denen diese Geschichte spielt. Der Laster, in den Sidonie und ihren Kinder Nicaise und Désiré verfrachtet wurden, hat ein unheilvolles Ziel: Ravensbrück, das KZ Ravensbrück. Das Schicksal der Dubreuils ist vorbestimmt worden. Für die Ruhestörer sind Juden und Neger nur Schweine. Sidonie weiß, was mit ihr passieren kann, sie hat davon gehört. Was ihr tatsächlich passieren wird, kann sie tatsächlich nicht einmal erahnen. Nur, dass ihr Leben wie sie es kannte, vorbei ist. Nicht mehr mit Madame Dubreuil in der Küche stehen und ihr die Geheimnisse der kreolischen Küche beibringen. Das selbst genähte Kleid für Nicaise – ob sie es an ihrem sechsten Geburtstag tragen kann?
Sidonie ist keine Jüdin, sie ist Katholikin. Das interessiert die Soldaten nicht im Geringsten. Das Freundlichste – sofern es das überhaupt gibt – ist das Lachen wegen ihrer Hautfarbe. Aber das ist nicht einmal ein schwacher Trost, es ist gar kein Trost.
Im Lager wird Désiré von Sidonie und Nicaise getrennt. Von anderen Insassen weiß Sidonie, dass ihr Sohn in einer Männerbaracke untergebracht wurde. Aber das beruhigt die junge Mutter nur ansatzweise. Denn der Mann, bei dem ihr bald einziges Kind unterkommt, ist der Mann, bei dem sie untergekommen war, der ihr eine Zukunft bieten konnte: Monsieur Debreuil. Er trägt immer noch den gelben Stern. Fast wünscht sie sich einen schwarzen Stern zu tragen…
Michèle Maillets „Schwarzer Stern“ ist eine fiktive Geschichte, die jedoch auf historischen Fakten basiert. Sidonie steht für eine Gruppe von Menschen, deren Schicksale bis heute nicht komplett aufgeklärt, geschweige denn aufgearbeitet wurden. Schwarze Haut in brauner Zeit – das war die Hölle. Sidonie kann sich an ihrem versteckten fiktiven Notizbuch/Tagebuch festhalten. Sie erinnert sich an Saint Pierre auf Martinique. Die Düfte, die Musik, die Lebensfreude. Das alles wird sie nie mehr wieder sehen. Die Kraft der Worte, die Michèle Maillet findet, ist das Stärkste, was man Rassismus und blindwütigen Vorurteilen entgegensetzen kann, ja sogar muss. Das Traurige daran ist, dass man es bis heute tun muss. Selbst Bücher wie „Schwarzer Stern“ haben Ressentiments gegenüber anderen Hautfarben, Religionen und Lebenseinstellungen nicht komplett aufheben können. Aber sie sind die permanenten Nadelstiche im Fleisch des Hasses. Davon kann es niemals genug geben!