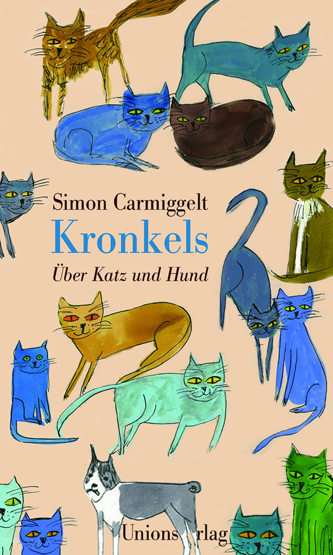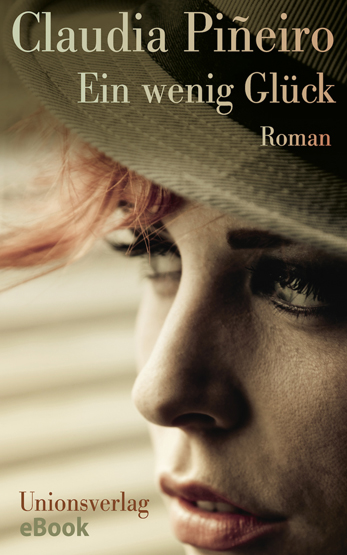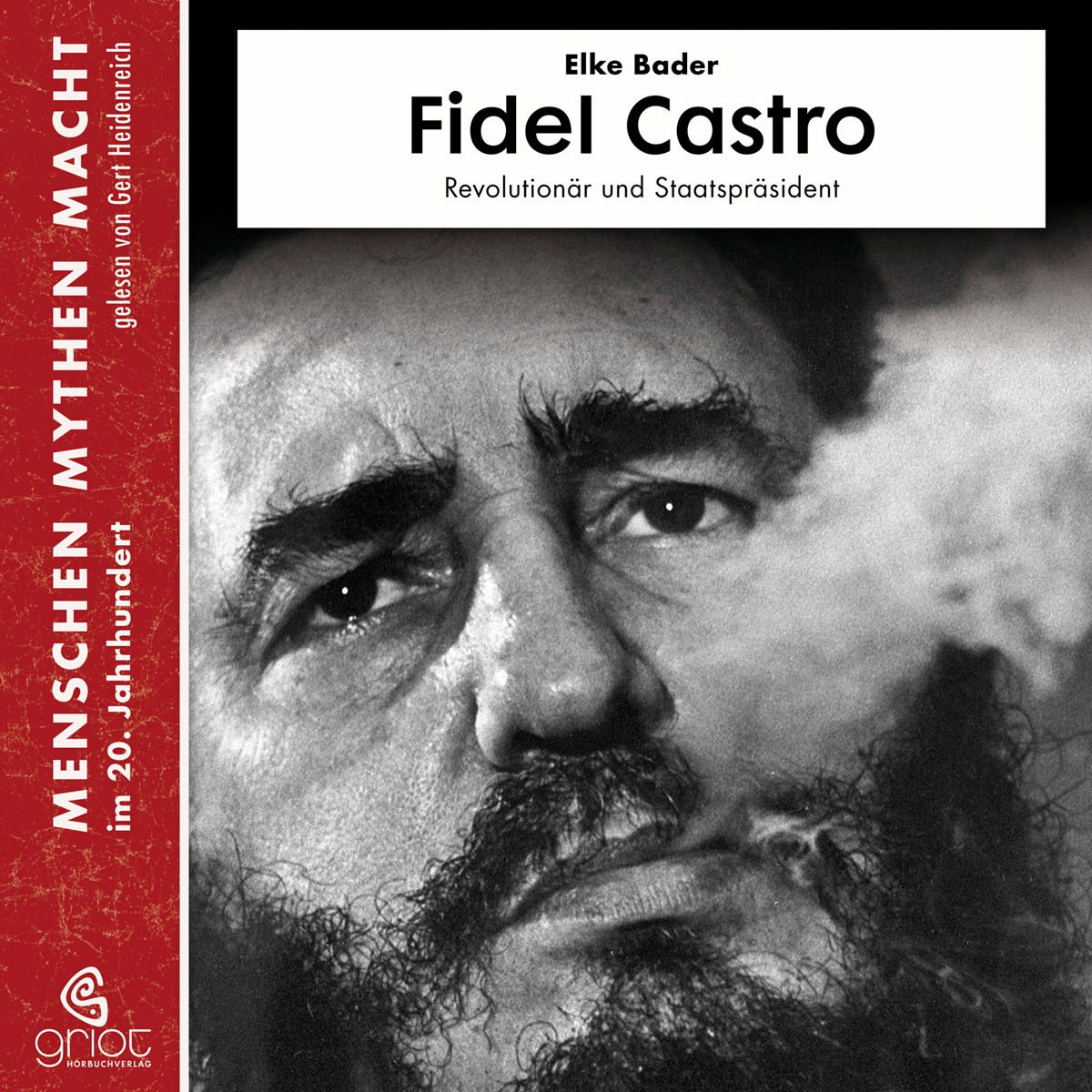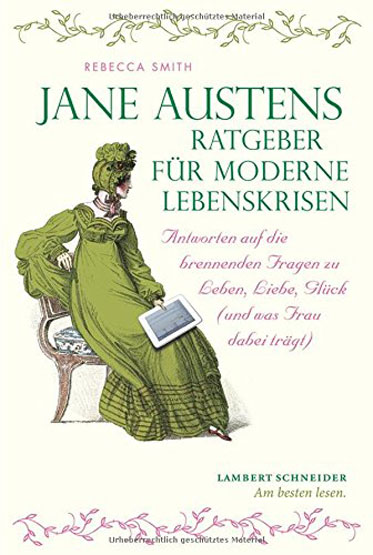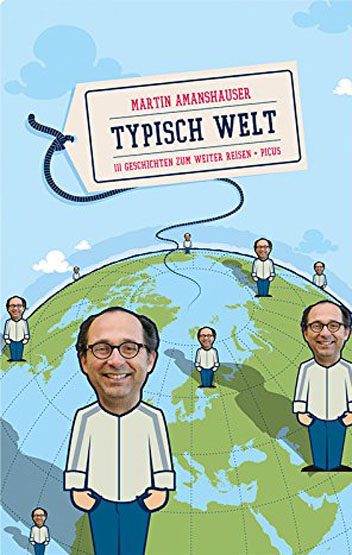Katzen sind wie Menschen. Sie sind mal nicht gut drauf, mal stromern sie herum ohne festes Ziel. Scheinbar! Als Katzeneltern hat man die gleichen Sorgen wie wenn man eigenen Nachwuchs aufs leben vorzubereiten hätte. Autor Simon Carmiggelt und seine Frau können Katzen nicht widerstehen. Und er, Simon, kann es einfach nicht lassen die schnurrigen Gesellen zu beobachten. Und, was für den Leser noch wichtiger ist: Alles aufzuschreiben! Selbst, wer keine Muschi, Pussy, Mieze oder wie auch immer man die Samtpfoten nun bezeichnen mag, sein eigen nennt, wird dieses Buch immer wieder gern zur Hand nehmen.
Soll man Tiere vermenschlichen? Nein! Doch wenn man sie beobachtet, also sie, die Tiere, kommt man unweigerlich auf den Trichter sie mit Menschen zu vergleichen. Hunger? Ab zum Futtertrog. Beim Menschen heißt der Kühlschrank. Ist man müde, legt man sich hin, streckt alles, was geht von sich und schlummert leise den Träumen entgegen. Was beim Menschen für keinerlei Aufsehen sorgt, ist bei Katzen immer ein Erlebnis. Glaubt man Simon Carmiggelt. Stress vor dem Theaterbesuch? Klar doch, immer wieder gern genommenes Thema. Doch bei Carmiggelt ist es nicht die Frau, die ewig im Bad braucht, noch einmal die Garderobe wechselt. Bei ihm sind es die Katzen. Da kann es schon mal zu Verzögerungen kommen, weil da draußen, vor dem Haus, noch ein Streuner „sein Unwesen treibt“, den man unbedingt aufnehmen muss. Und im Theater? Da sorgt man sich um die lieben Kleinen bzw. ums Haus. Katzen sind halt auch nur Menschen. Wie ihre Besitzer. Nur anders!
Und Hunde? Ebenso. Der Autor war kein Hundebesitzer, aber er mochte sie, beobachtete sie mit der gleichen Leidenschaft wie er seine Katzen mit den wachen Augen eines Neugierigen verfolgte. Und auf seinen Streifzügen durch Amsterdam, wo er bekannt war wie der sprichwörtliche „bunte Hund“, begegneten ihm einige besondere Exemplare: Störrische, Verschreckte, Liebevolle.
Allen Katzen und Hunden seiner Familie und seiner Stadt hat Simon Carmiggelt mit seinen Kolumnen ein Denkmal gesetzt. Und das tagtäglich. Die „Kronkels“ waren mehr als nur ein Spaltenfüller in einer Tageszeitung, manche Leser gingen so weit zu sagen, dass die Tageszeitung das Beiwerk der „Kronkels“ war. Die Geschichten sind nicht lang, doch stecken sie voller Überraschungen und sprudeln vor Wortwitz. Ein bisschen Tucholsky und ein bisschen Kästner. Garniert mit der Spritzigkeit und der Agilität eines wachen Verstandes – das sind die Kronkels von Simon Carmiggelt!