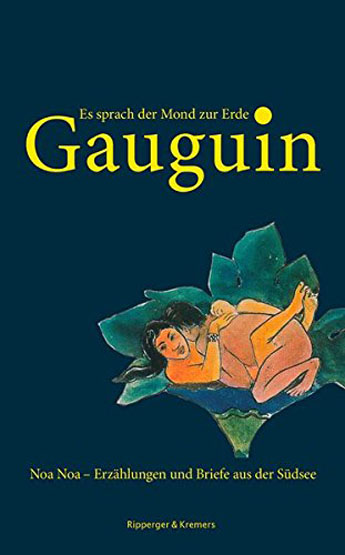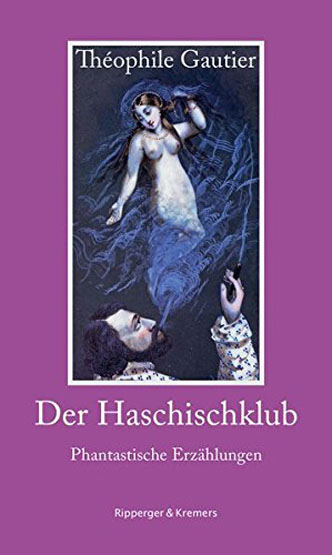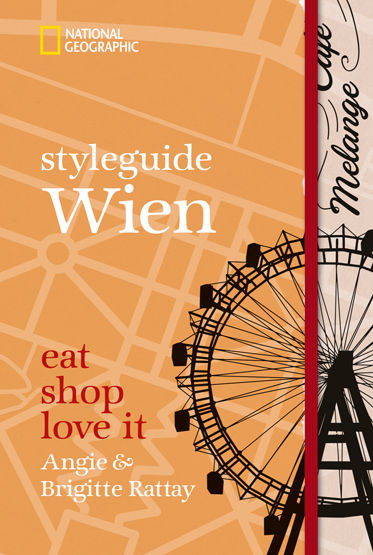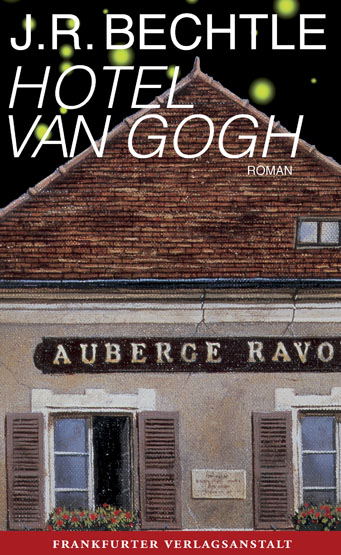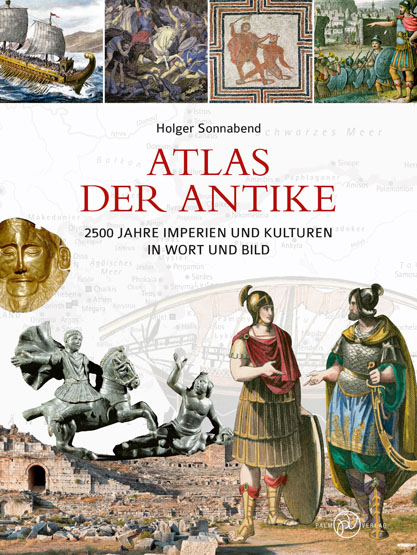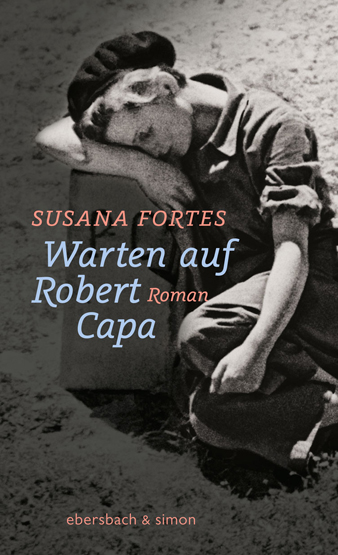Seit Hunderten von Jahren gilt Tahiti als das Sehnsuchts-Traumziel schlechthin. Das Rauschen des Meeres, die exotische Gastfreundschaft der Maori, das immer währende „schöne Wetter“ und und und. Fletcher Christian war der erste, der hier das paradiesische Leben genoss. Eine Romanfigur. Das war im 18. Jahrhundert. Rund hundert Jahre später kam einer, der echt war: Paul Gauguin. Angeödet, angewidert, enttäuscht vom Leben in Europa zog er sich nach Tahiti zurück. Kehrte wieder heim, war wieder angeödet, angewidert und enttäuscht und wand sich endgültig dem sorgenfreien Leben unter der Südseesonne zu.
Doch das Leben auf Tahiti war weder einfach noch erfüllend. Alles so fremd, alles so fern von daheim, und doch: So organisiert und überhaupt gar nicht so frei wie er es sich vorstellte. Denn die Kolonialmacht Frankreich hatte hier schon so einige Dinge eingeführt, um die Verwaltung zu vereinfachen. Und doch war es der Startschuss für ihn und seine Karriere. Wer Paul Gauguin bisher nur als Maler kannte, wird mit „Es sprach der Mond zur Erde“ verstehen warum es den Maler hier hielt. Die Farbenpracht der Inseln, die für ihn eigenartige, schillernde Hautfarbe der Menschen, vor allem der Frauen, faszinierten ihn.
Der Sprache gar nicht bis kaum mächtig, erobert er sich seine neue Welt. Alles ist neu. Selbst einfache Gesten sind ihm fremd. Doch er lernt schnell! Auch das Ritual der Vermählung, inkl. der achttägigen „Probezeit“. Ein junges Mädchen wird „ihm angeboten“, von der Mutter. Dann wird ihm ihre Mutter vorgestellt. Was? Noch eine Mutter? Ja und nein. Die eine hat die geboren, die andere gesäugt.
Das Klima ist ihm zuwider. Die Hitze macht ihm zu schaffen. Doch das Licht, die Eindrücke und letztendlich die Befreiung von alles Sorgen und Zwängen lassen ihn nicht weiter zweifeln: Hier ist er zuhause!
„Noa noa“ heißt in der Sprache der Maori Duft. Für Gauguin duftet es nach Abenteuer, obwohl er sich nie wie ein Abenteurer fühlt. In seinem Kopf schlagen die Ideen Purzelbäume. Malen, malen, malen – er kann an nichts anderes mehr denken. Ablenkung verschaffen ihm immer wieder der Alltag und die täglichen neuen Entdeckungen.
Die in diesem Buch niedergeschriebenen Erinnerungen (und kunstvoll hinzugedichteten Phantasien) stammen von der ersten Reise Gauguins nach Tahiti in den Jahren 1891/93. Ein bis heute nicht vollends geklärter Streit mit seinem Freund Vincent van Gogh, der dem Holländer ein Ohr kostete, die Erfolglosigkeit als Maler und die Zukunftslosigkeit trieben ihn weit weg von der Heimat. Auf Tahiti schöpfte er neuen Mut und Schaffenskraft. Und schlussendlich auch finanzielle Sicherheit. Denn die auf Tahiti entstandenen Bilder ließen sich in der Heimat tatsächlich verkaufen. Beziehungsweise fand er in Ambrose Vollard einen Gönner, der ihm regelmäßig Geld schickte. Und mit Tehura fand er die Frau fürs Leben.
Wer in Paul Gauguin bisher immer nur als den Maler mit den vielen „nackten Weibern aus einer weit entfernten Welt“ sah, wird in diesem Buch den Menschen hinter den Bildern kennenlernen und teilweise verstehen können. Wozu auch die zahlreichen Abbildungen von Gauguins Bildern beitragen. Die Rituale der Ureinwohner, Gauguins Sichtweise auf sein neues Leben und die Rückschau auf das, was war, vervollkommnen das Vorwissen über einen der eindrucksvollsten Maler der vergangenen anderthalb Jahrhunderte. Die Originalausgabe von „Noa noa“ wird um einige Briefe und Aufzeichnungen ergänzt, so dass das literarische Werk Gauguins immer mehr an Bedeutung gewinnt. Er war eben mehr als nur der Maler der „nackten Weiber aus einer weit entfernten Welt“.