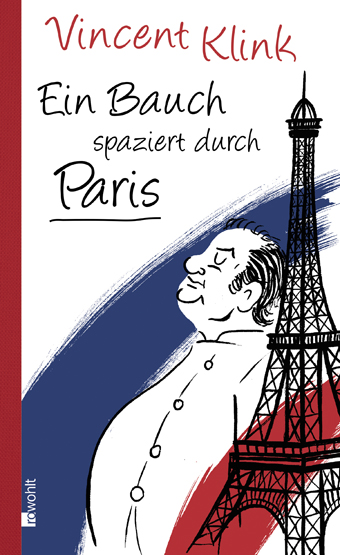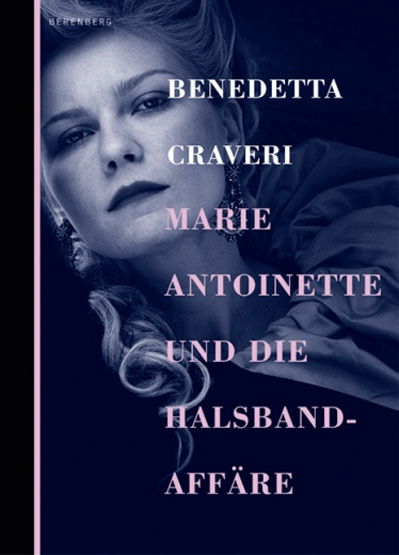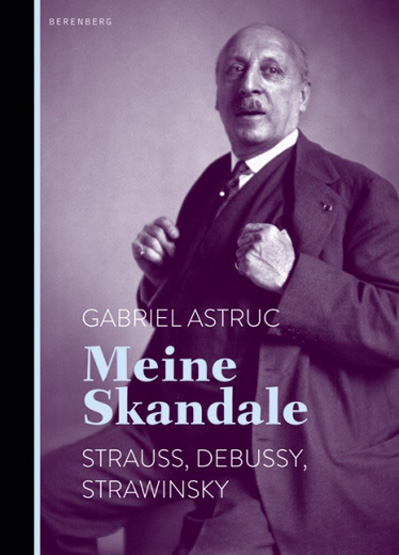Das Jahr mit einem oder mehreren guten Vorsätzen beginnen, gehört einfach dazu. Genauso wie das Verleugnen selbiger, sobald der Alltag wieder eingekehrt ist. Was hat man doch gleich zu Beginn sich vorgenommen? Vergessen! Is auch egal. Oder doch nicht?! Hätte man sich zwischen Sekt, Böllerei und Völlerei doch mal die eine oder andere Idee aufgeschrieben. Dann könnte man jetzt nachschlagen.
Ein Vorsatz war bestimmt ein besserer Umgang mit den Menschen und sich selbst. Dieser Kalender erinnert einen jede Woche mit einem anderen Spruch daran wie verletzlich der Mensch, seine Umwelt und die Wechselbeziehungen sind. Gelassener den Alltag gestalten, besonnen agieren oder einfach mal zuhören. Das Besondere an diesem Kalender sind nicht die Sprüche an sich. Die gibt es zuhauf auf unzähligen Kalendern. Auf der Rückseite werden die Weisheiten in den richtigen Kontext gesetzt. Denn wer am frühen Morgen noch etwas schlaftrunken sich mit Jahrhunderte alten Sätzen beschäftigen muss ohne an die Hand genommen zu werden, ist verloren. Und dann ist es wie jedes Jahr: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?!
Selbstreflexion ist nichts mit dem man fahrlässig umgeht. Doch zwischen Optimierung und den täglichen Pflichten wird sie oft in den Hintergrund gedrängt. Geduld haben mit jedem Tag des Lebens haben, ist eine Weisheit aus dem fernen Osten. Das soll nicht bedeuten, erst dann zur Arbeit zu erscheinen, wenn es einem passt. Es ist auch die Aufforderung sich Gewohnheiten entgegenzustellen, den eigenen Denkkreis zu erweitern und somit sich stets neuen Herausforderungen zu stellen.
Der Tischkalender „Achtsamkeit“ ist kein Lehrer, der zur Achtsamkeit ermahnt. Er hält dazu an mit offenen Augen durchs Leben zu schreiten. Gegebenes muss nicht immer in diesem Status verweilen. Das, was da ist, ist der Startpunkt, nicht der Weg oder das Ziel. Und am Ende des Jahres kann man getrost sich neue Vorsätze vornehmen. Denn im vergangenen Jahr hat es ja ganz gut geklappt…