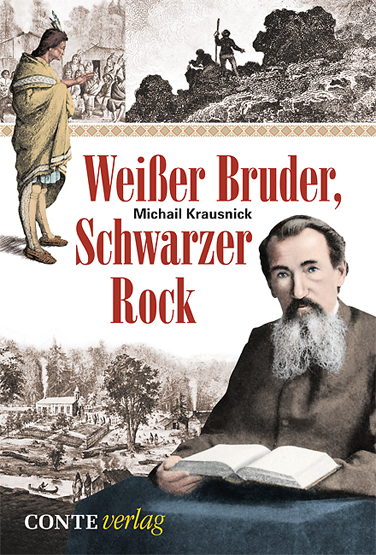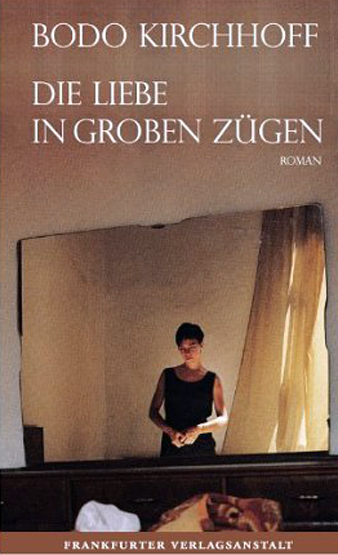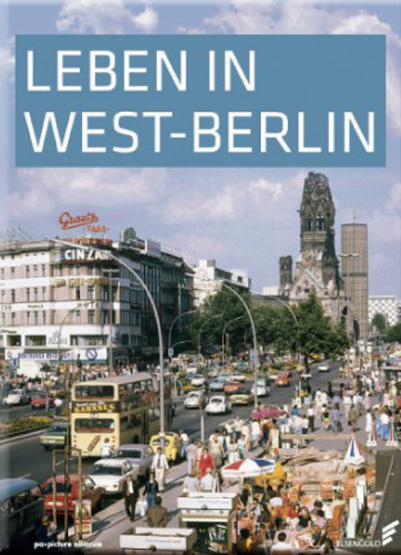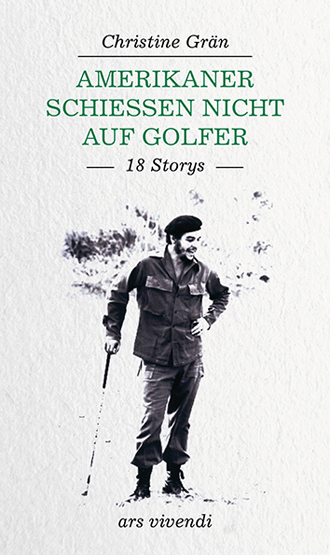Durch das Internet sind viele Behördengänge unnötig geworden. Noch vor zwanzig, dreißig Jahren waren lange Wartezeiten, unkontrolliertes Hin-und-Herlaufen an der Tagesordnung. Wie bei Asterix sagten damals viele. Oder, dass man von Pontius zu Pilatus geschickt wurde. Gott sei Dank hatte dann auch dieser Tag mal ein Ende. Man fühlte sich wie im siebten Himmel, nach dem man mit Engelszungen auf jemanden eingeredet hatte und nicht immer zu allem ja und Amen gesagt hat. Hatte man das gewünschte Formular, hütete man es wie seinen Augapfel, verlor man es, spuckte man Gift und Galle, weil einem alles über den Kopf wuchs und keine Menschenseele einem helfen konnte. Und zu Hause musste man höchstpersönlich die Hiobsbotschaft überbringen. Man kam einfach auf keinen grünen Zweig. Um das Dutzend voll zu machen: Man wurde auf Herz und Nieren geprüft.
Schon in diesen wenigen Sätzen ist ein Dutzend Sätze versteckt, die allesamt auf das Buch der Bücher zurückgehen. Egal, ob man religiös ist oder nicht: Die Bibel hat immer noch einen gehörigen Einfluss auf unser Leben. Niemand kann sagen, dass er seien Hände in Unschuld wäscht, wenn es um Sprachbilder aus der Bibel geht. Sprachbilder machen eine Sprache erst lebendig. Man kommt schon beim bloßen Durchblättern ins Staunen (Da stehen einem die Haare zu Berge), wenn man sieht, wie oft man selbst die Bibel zitiert bzw. auf ihr basierende Redewendungen verwendet.
Man muss deswegen kein schlechtes Gewissen haben. Man darf ruhig ein Herz und eine Seele mit der Sprache sein. Schlimm wird’s nur, wenn man das gesagte nicht erläutern kann, einfach etwas nachplappert, was andere vorgeben. Zum Abschaum der Menschheit gehört man deswegen noch lange nicht, aber es schadet nicht, wenn man weiß, warum man mit Engelszungen auf jemanden einredet.
Gerhard Wagner hat dem Volk und der Bibel aufs Maul geschaut – nein, das ist keine Redewendung aus der Bibel, nur, wenn er es stopfen würde, dann ja – und eines der interessantesten Sachbücher zum Thema Sprachgebrauch zusammengestellt. Er hat ja auch schon Übung. Aus seiner Feder stammen auch die Bücher „Das geht auf keine Kuhhaut“ und „Also sprach Zeus“, die sich mit Redewendungen aus dem Mittelalter und der Antike beschäftigten.
Sprache ist formbar. Sie unterliegt ständiger Veränderung. Es ist wie immer: Bewährtes, Gutes hält sich. Dieses Buch wird auf lange Sicht ein Klassiker bleiben!