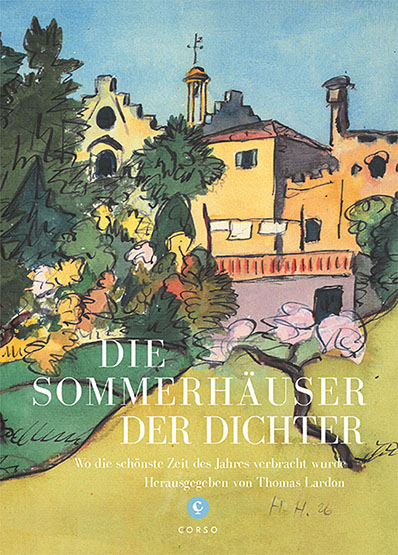Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man vor einem Bild steht und nicht mehr nur daran denkt wie hübsch dieses Bild überm Sofa aussehen würde. Das Bild gefällt, aber … warum eigentlich. Fast schon ein bisschen neidisch schielt man dann zu offensichtlichen Kunsthistorikern hinüber lauscht staunend den Ausführungen über Pinselführungen, Strichlänge, dem Besonderen des Bildes. Und das alles sehen die auf den ersten Blick?! Zweifel macht sich breit. Erzählen kann man ja viel.
Martina Clavadetscher gibt den Damen auf berühmten Bildern eine Stimme. Die Damen sind meist unbekannt, ihre Erschaffer dafür umso mehr. Wer kennt schon Cecilia Gallerani? Das ist die, die von Leonardo da Vinci ein ungewöhnliches Haustier auf den Arm gelegt bekam. Und er malte sie. Zu sehen heutzutage in Krakow, auf den Wawel-Burg. Extra Eintritt, nur für Signora Gallerani. Es ist nicht mehr und nicht weniger „Die Dame mit dem Hermelin“. Und die erzählt frei von der Leber weg wie es sich anfühlte vom großen Meister portraitiert zu werden.
Ebenso wie Margherita Luti – noch so eine Dame, deren Namen man nicht kennt. Und dabei lehnt sie lasziv, entspannt, die Brust entblößt an der Wand. Gemalt von Raffael. Er das Malergenie, das schon im Teenageralter als Meister galt – sie wäre in der heutigen Zeit eine Bäckereifachverkäuferin. Sie ist nicht auf den Mund gefallen als sie den spannenden Raffaello entdeckt, während sie im Gras entspannt. Er ist mit einer Anderen liiert, was sie – Margherita – verärgert und zu Spottgesängen anheben lässt. Noch heute munkelt man, dass sie und er mehr als nur Meister und Modell waren. Das alles geschah vor mehr als fünfhundert Jahren. Und noch immer fasziniert das Gemälde und seit Neuestem auch die Geschichte darum, dank dieses Buches.
Und so liest man sich Seite für Seite durch die Kunstgeschichte, lernt Damen und ihre Meister kennen. Mit unbeirrter Leichtigkeit ergreifen Damen das Wort, die teils seit Jahrhunderten stumm von den Wänden der größten Museen der Welt dem Betrachter in ihren Bann ziehen. Lichtwechsel, Schattenspiele, Liebreiz, Zartheit – unerreichbar für jedermann. Manche sogar hinter Glas oder so weit entfernt, dass es nicht einmal ansatzweise so was wie Nähe geben kann. Sie alle sind empfindsam, stolz, schüchtern, verängstigt. Und sie haben eine Geschichte. Nicht immer so skandalös wie die von Olympia als sie Èdouard Manet ganz und gar nicht keusch auf der Ottomane malte. Dennoch erzählenswert.
Es ist nicht die Frage wird hier wen verführt. Nicht jeder ist verführbar. Erstmals werden in diesem Umfang Damen von Damals nicht vorgeführt, sondern in die Gesellschaft der Besucher eingeführt. Sie stehen neben einem und erzählen, was bisher niemand wusste. Und das vor aller Augen…