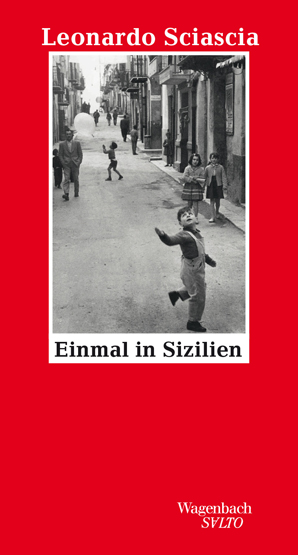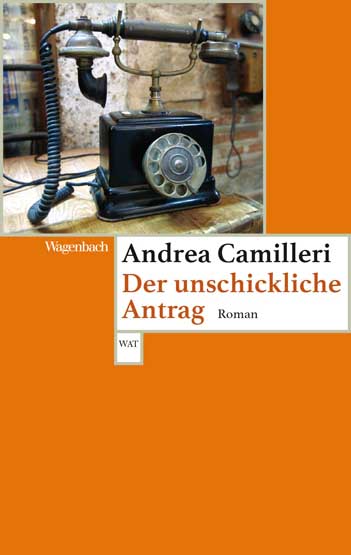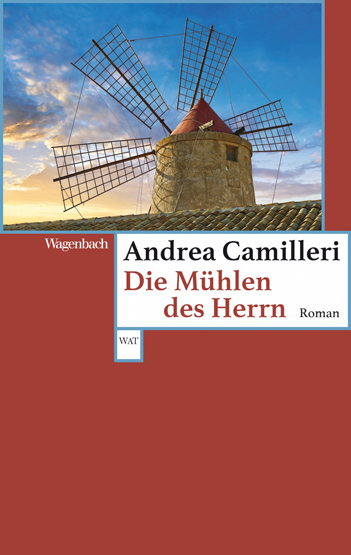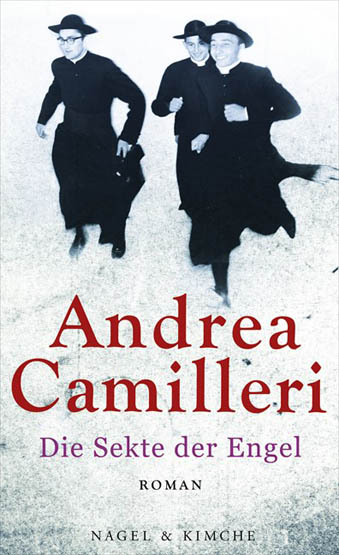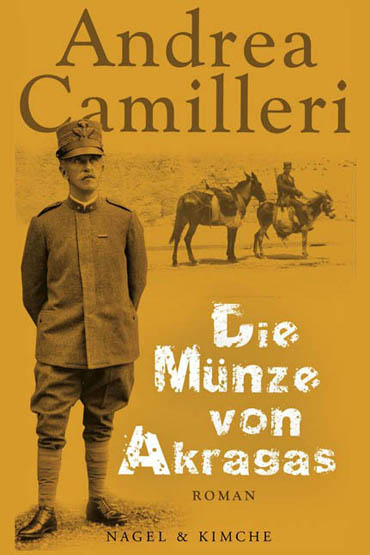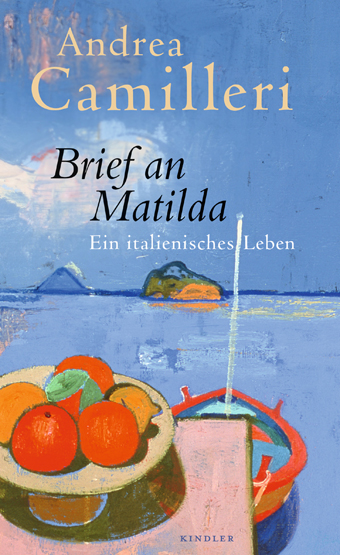Eine Frage sollte man sich während und nach der Lektüre dieses Buches auf gar keinen Fall stellen: Ist Palermo noch ein Reiseziel für mich? Verzichten, weil man hier lieber die erhaltene Hälfte abreißt, statt die zerstörte Hälfte wieder aufzubauen? Verzichten, weil erstmal ewig diskutiert wird, wer, was, wie in Ordnung bringt (klingt wie deutsche Politiker bei der Lösungsfindung der Coronakrise!)? Nein, denn das Chaos hat System. Ein System, das funktioniert. Und weil die Stadt allen Klischees und Vorurteilen zum Trotz mehr Herz hat, als so mancher Werbeslogan anderswo.
Roberto Alajmo ist Palermitano, wurde hier geboren, lebt hier. Er kennt seine Stadt, er liebt sie. Und er sieht wie sie wirklich ist und wie sie sich verändert hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, soll Palermo wirklich aussehen wie eine gentrifizierte, durchgestylte Metropole, die aussieht wie jedes stinknormale Kaufhaus auf dem Planeten? No, alles nur das nicht!
Zwölf Kapitel widmet er Palermo, zwölf Rundgänge zwischen den einzigartigen Fassaden bis hinein in die Köpfe und den Bauch der Palermitani.
Alajmo beginnt mit der Charakterisierung der Einwohner Palermos, den Palermitani. So vielfältig die Arten des Caffes, den man hier nicht trinkt, sondern zelebriert, so vielschichtig sind die Palermitani selbst. Eine gewisse Faulheit könne man ihnen, wie allen Sizilianern, unterstellen. Doch nicht nach dem Motto „das können die Anderen machen“. Sie treibt vielmehr der Drang an sich mitzuteilen, das eigen Wissen in die Problemlösung einfließen zu lassen. Dass dabei auch mal ein paar Jahre ins Land ziehen können, nimmt man gelassen hin.
Nur beim Essen gibt es keine zwei Meinungen. Es gibt sogar mehrere. Jeder Stadtteil, jede Straße, jedes Haus, jede Familie kennt ihr eigenes Rezept für ein und dieselbe Sache. Abwechslung auf dem Teller ist also garantiert. Und immer schön auf sich selbst stolz sein. So sind sie die Palermitani!
Was zunächst als Abrechnung zu beginnen scheint, wandelt sich mit jedem Umblättern zu einer offensichtlichen Liebeserklärung. Die direkte Ansprache an den Leser, der sich Palermo ansehen möchte, oder vielleicht sogar schon im Hotel auf dem Bett in dem Buch blättert, lässt keinen Widerspruch zu. Palermo muss man gesehen – wozu sonst soll man auf dieser Welt sein?! Schicht für Schicht schält sich eine einzigartige Welt aus sich selbst heraus. Tränen fließen keine. Denn Roberto Alajmos Worte sind das schärfste Messer, das durch die Zwiebel Palermo gleitet.