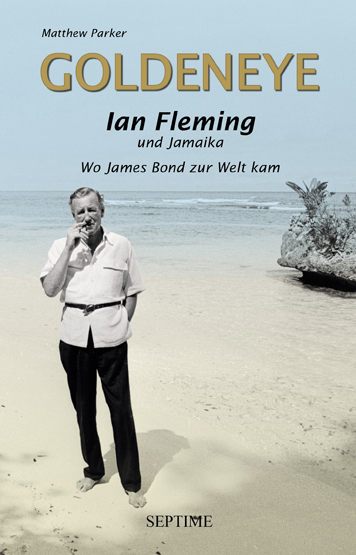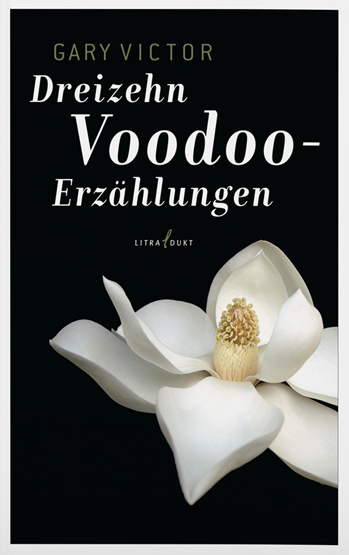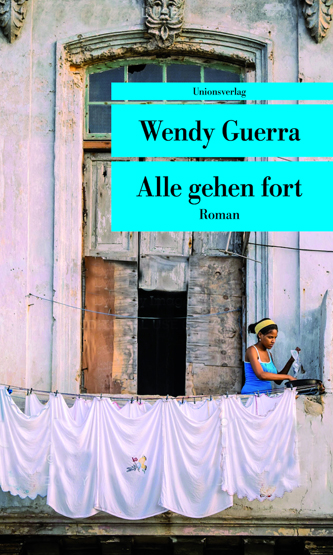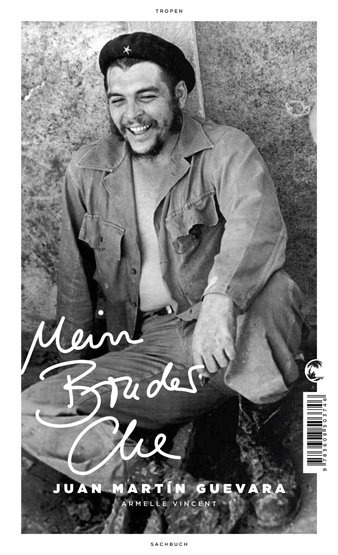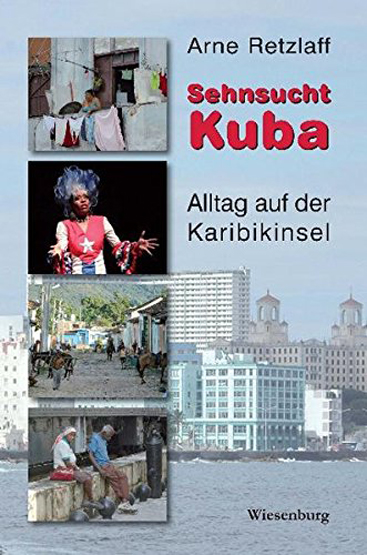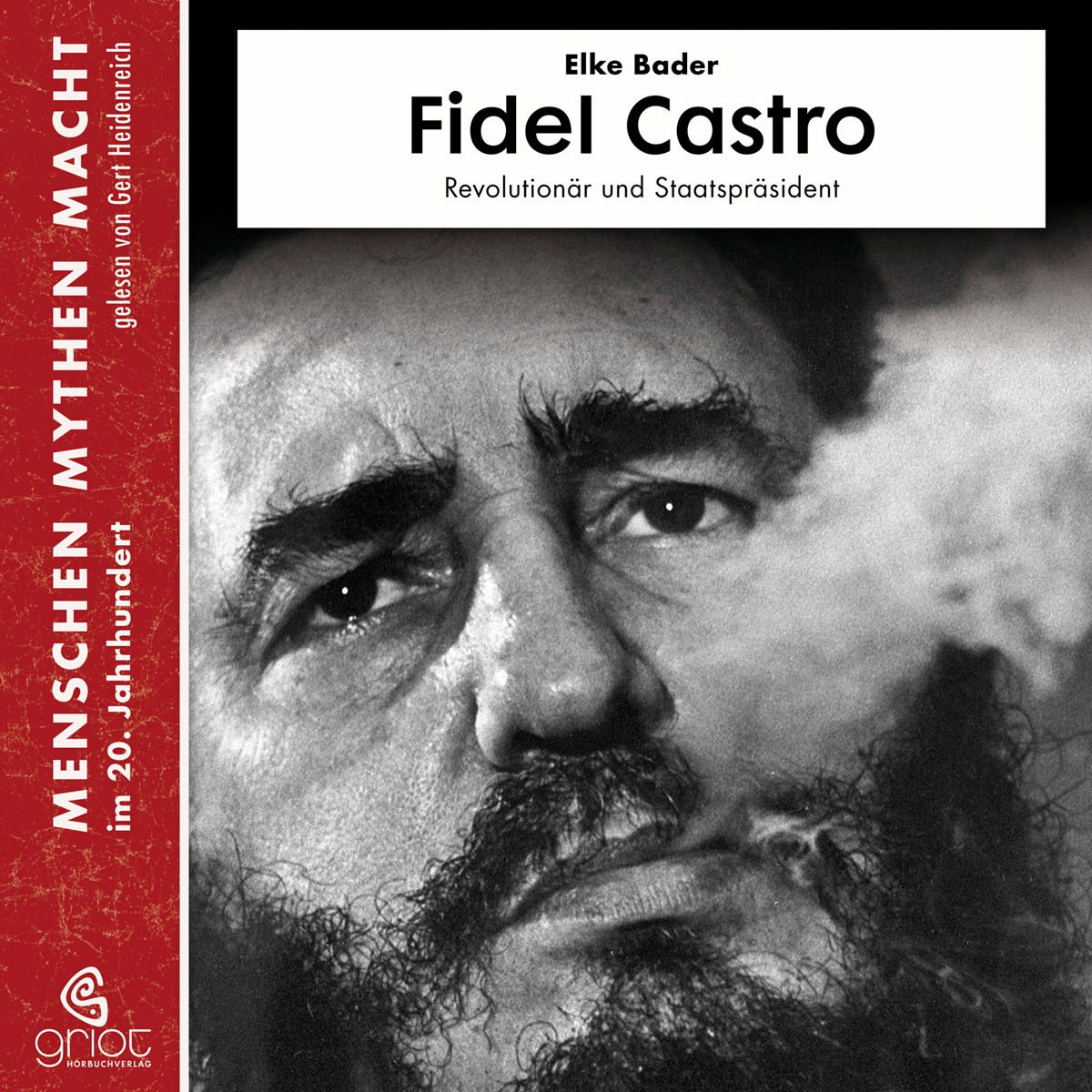Das Leben könnte so schön sein. Emmanuela hat eigentlich alles, was man sich wünscht. Vielmehr als die meisten auf Haïti. Sie hat eine Familie, eine Arbeit, die ihr das gewünschte Leben ermöglicht. Cousine Paula, von allen nur Couz genannt, ist eigentlich die Einzige, die ab und zu mit ihren Geschichten nervt.
Doch seit einiger Zeit umschlingt Emmanuela eine nicht greifbare Unruhe. Sind es die Geschichten von Couz, die ihr Angst machen? Die behauptet, dass ein Geist Besitz von der gesamten Familie ergriffen hat. Und Beweise, wenn man sie so nennen kann, hat sie auch parat. Die Todesdaten von Familienangehörigen sind allesamt äußerst kurios. Oder ist es doch nur die beginnende Menopause, die Emmanuela einfach nicht zur Ruhe kommen lässt. Eine rituelle Kopfwaschung soll dabei Abhilfe schaffen.
Serge, der Mann an Emmauelas Seite ist wenig erfreut über das Ritual, das sie über sich ergehen ließ. Doch ist er Manns genug ihr keinerlei Vorschriften zu machen. Als er bei sich zuhause ankommt, ist auf einmal alles anders. Das Knurren seiner Hund ist beunruhigend… Und Emmanuela weiß nun ganz genau, dass Yvo, der Geist, den einst ihr Großvater „ins Haus schleppte“ erneut sein Unwesen treibt…
Haïti und Voodoo gehören zusammen wie Eiffelturm und Paris. Dessen muss man sich gewiss sein, wenn man Kettly Mars‘ neuen Roman „Der Engel des Patriarchen“ lesen will. Keine Spinnerei wie im Film, in denen sich Besessene ins Feuer stürzen, in denen die Macht des Voodoo missbraucht wird, um die Macht zu stützen. Voodoo ist eine Religion, die man genauso ernst nehmen soll wie jede andere Religion. Mit dieser Einstellung wird dieser Roman zu einem Leseerlebnis der besonderen Art.
Die Sätze umschmeicheln den Leser wie Seide. Langsam bedecken sie die Phantasie und hinterlassen eine Welt, die so fremd erscheint, dass man sie gar nicht als real empfindet. Es sind keine Märchen, die Kettly Mars dem Leser vorsetzt. Echte Geschichten, wahre Empfindungen.